Die Regierungsfraktion der GRÜNEN in Baden-Württemberg soll sich in Abstimmung mit
anderen Bundesländern und dem Koalitionspartner im Bundesrat zum nächstmöglichen
Zeitpunkt für die Vorbereitung und Einreichung eines partei- und länderübergreifenden AfD-
Verbotsantrags beim Bundesverfassungsgericht noch im Jahr 2025, spätestens 2026
einsetzen.
Begründung
Von Bundestag und Bundesregierung ist realistisch kein Antrag zu erwarten. Wir setzen
daher auf den Schulterschluss der Länder, zumal es aus anderen Bundesländern
entsprechende Signale gibt.
- Die AfD stellt eine reale Gefahr für die Demokratie dar
1.1. Die AfD propagiert ein völkisch-abstammungsbasiertes Volksverständnis
Im Zentrum der Ideologie der AfD steht ein „völkischer Nationalismus“, der nicht mit dem
Grundgesetz vereinbar ist. Laut Analyse des Verfassungsschutzes orientiert sich die Partei
an einem ethnischen Volksbegriff: Danach gehört nur zur deutschen Nation, wer „deutsches
Blut“ hat – also deutsch im Sinne von Abstammung ist. Wer keine deutschen Großeltern hat,
gehört nach AfD-Verständnis nicht zum deutschen Volk. Diese Definition widerspricht dem
modernen, inklusiven Staatsbürgerinnenbegriff unserer Verfassung, der von Gleichheit, Menschenwürde und Pluralität ausgeht.
1.2. Die AfD betreibt gruppenspezifische Menschenfeindlichkeit Die AfD hat sich in den letzten Jahren immer weiter radikalisiert. Besonders betroffen von ihrer Hetze sind:
- Menschen mit Migrationsgeschichte, denen pauschal Kriminalität, „Integrationsverweigerung“ und „Islamisierung“ unterstellt wird.
- Musliminnen, über die regelmäßig verallgemeinernd gesprochen wird – als Gefahr,
Bedrohung oder „Fremdkörper“. - queere Menschen, die durch die AfD in ihren Grundrechten attackiert werden – etwa
durch die Ablehnung von Selbstbestimmungsgesetzen oder queerer Bildungsarbeit. - Geflüchtete, über die die AfD gezielt Ängste schürt, sie als „Belastung“ darstellt und
deren Rechte sie massiv beschneiden will.
Begrifflichkeiten wie „Remigration“, „Bevölkerungsaustausch“ oder „Messermigranten“ –
durch die AfD bewusst ins Zentrum der öffentlichen Debatte gebracht – stammen direkt aus
dem Wortschatz rechtsextremer Bewegungen wie der Identitären Bewegung. Dass solche
Begriffe in Landtagen oder im Bundestag fallen, zeigt, wie sehr sich rechtsextremes
Gedankengut normalisiert hat. Diese Normalisierung bereitet den Boden für einen rasanten
Anstieg rechtsextrem motivierter Straf- und Gewalttaten durch Einzeltäterinnen und Gruppierungen (siehe BKA-Bericht 2024). 1.3. Die AfD relativiert den Nationalsozialismus AfD-Funktionärinnen verharmlosen regelmäßig die Verbrechen des Nationalsozialismus.
BEGRÜNDUNG
- Björn Höcke sprach vom Holocaust-Mahnmal als „Denkmal der Schande“.
- Andere AfD-Politiker*innen forderten, „endlich einen Schlussstrich zu ziehen“.
- In der AfD-Fraktion sitzen wiederholt Personen, die sich öffentlich positiv über die SS
oder über NSDAP-Positionen geäußert haben. - Die AFD-Bundestagsfraktion beschäftigte 2024 über 100 Mitarbeitende aus dem
rechtsextremen Milieu. Dies ist kein Randphänomen, sondern Ausdruck einer
Parteistruktur, die versucht, die deutsche Geschichte umzudeuten, Verantwortung
abzustreifen und die ideologische Grundlage für völkisch-nationalistische Politik zu
schaffen. - Die AfD will demokratische Prinzipien systematisch untergraben. Es geht der AfD nicht
nur um „andere Meinungen“. Die Partei zielt darauf, die freiheitlich-demokratische
Grundordnung zu untergraben. Dazu zählen:- die Unabhängigkeit von Justiz und Medien,
- die Gleichwertigkeit aller Menschen,
- der Schutz von Minderheiten,
- sowie die Gewaltenteilung.
- Die AfD stellt diese Grundprinzipien regelmäßig infrage. Die Partei ist nicht einfach „rechts“,
sie ist verfassungsfeindlich. Ihre politischen Ziele zielen auf ein autoritäres, nationalistisches
System ab, das mit dem demokratischen Pluralismus unvereinbar ist.
- Die Partei nutzt parlamentarische Strukturen zur Sabotage
2.1. Strategische Blockade in Parlamenten
Die AfD missbraucht parlamentarische Positionen, um demokratische Prozesse zu lähmen.
In Thüringen legte der AfD-Alterspräsident 2024 die konstituierende Landtagssitzung lahm,
indem er sich weigerte, über Anträge anderer Fraktionen abstimmen zu lassen. Die Sitzung
musste abgebrochen werden – erst ein Urteil des Thüringer Verfassungsgerichts beendete
den rechtswidrigen Zustand. Dieses Verhalten ist kein Einzelfall, sondern Strategie:
Die AfD nutzt Regelwerke, Geschäftsordnungen und parlamentarische Pflichten nicht, um
konstruktiv mitzuwirken – sondern um Institutionen gezielt zu beschädigen und das
Vertrauen in die Demokratie zu untergraben.
2.2. Aufbau rechtsextremer Parallelstrukturen
Über ihre Verankerung in Parlamenten hinaus baut die AfD Verbindungen zu rechtsextremen
Netzwerken auf:
– Kontakte zur Identitären Bewegung,
– Unterstützung durch rechtsextreme Medienakteure,
– Teilnahme von AfD-Funktionärinnen an Geheimtreffen mit Vertreterinnen von
Neonazigruppen (z. B. das Potsdamer Treffen zur „Remigration“).
Diese Netzwerke verfolgen Strategien, um demokratische Institutionen systematisch zu
destabilisieren. Die AfD ist integraler Teil dieser Pläne.
2.3. Institutionelle Aushöhlung und Normalisierung
Die AfD wird durch Teilhabe an Ausschüssen, Parlamenten und durch mediale Präsenz
zunehmend als „legitime“ Kraft wahrgenommen – obwohl sie sich programmatisch und
personell außerhalb des demokratischen Konsenses stellt. Diese Normalisierung schwächt
die demokratische Kultur – denn was als „normal“ gilt, prägt unsere gesellschaftliche Mitte.
Diese Mitte will die AfD laut ihrem jüngsten Strategiepapier von Juli 2025 gezielt aushöhlen,
indem sie “durch Polarisierung zwischen AfD und Linke, SPD und Grüne nach links zwingen”
und die “Gegensätze zwischen Union und SPD unüberbrückbar machen” will. Die
Verhinderung der bereits mit den Grünen abgeklärten Wahl der Jura-Professorin Frauke
Brosius-Gersdorf zur Verfassungsrichterin war als gezielt inszenierte Kampagne jüngst ein
Beispiel dafür. Sie hat indirekt auch das Verfassungsgericht beschädigt, indem es eine
Kandidatin als voreingenommen, parteiisch und unqualifiziert darstellte.
- Die juristischen Voraussetzungen sind gegeben
3.1. Die juristischen Voraussetzungen sind voraussichtlich gegeben
Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes ist klar:
„Parteien, die nach ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer Anhängerinnen darauf ausgehen,
die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen, sind
verfassungswidrig.“*
Die AfD erfüllt diese Kriterien voraussichtlich:
- Das 1.100 Seiten umfassende Gutachten des Bundesamts für Verfassungsschutz
bewertet die Bundespartei der AfD seit 2024 als „gesichert rechtsextremistisch“. Diese
Einschätzung basiert nicht nur auf einzelnen Aussagen, sondern auf einer
systematischen Analyse von Parteiprogrammen, Strategien und dem Verhalten von
Funktionär*innen und Mitgliedern. Auch wenn das Gutachten noch nicht rechtskräftig ist,
ist es doch ein klares Indiz für die Verfassungswidrigkeit der AfD. - Auch das Deutsche Institut für Menschenrechte kommt in seiner juristischen
Einschätzung von 2023 zu dem Ergebnis, dass die AfD in ihrer Programmatik insgesamt
verfassungsfeindlich sei – nicht nur „in Teilen“. Die Partei strebe offen eine autoritäre,
ethnisch homogene Ordnung an, die fundamentale Prinzipien der Demokratie wie
Gleichheit, Menschenwürde und Pluralismus gezielt aushöhlt. - Das Ausscheiden der NPD aus dem politischen Raum wurde 2017 vom
Bundesverfassungsgericht u. a. deswegen nicht per Verbot durchgesetzt, weil die Partei
als bedeutungslos galt und keine reale Gefahr für die Demokratie mehr darstellte. Bei der
AfD liegt genau das Gegenteil vor: Sie ist in mehreren Landesparlamenten zweitstärkste
Kraft, hat Sperrminoritäten inne und besetzt Schlüsselpositionen im Bundestag.
3.2. Die Zeit drängt – und die Länder müssen handeln
Ein Verbotsverfahren ist ein langer, aber notwendiger Weg. Es braucht umfassende Beweise,
eine gründliche juristische Prüfung und einen breiten politischen Schulterschluss. Doch
solange sich Bundesregierung und Bundestag nicht klar positionieren, liegt die
Verantwortung bei den Ländern.
Baden-Württemberg ist Regierungsland mit grüner Beteiligung. Als solches trägt es eine
besondere Verantwortung.
Karlsruhe als Sitz des Bundesverfassungsgerichts steht symbolisch wie real für wehrhafte
Demokratie. Lasst Karlsruhe entscheiden – aber lasst es nicht unversucht.
- Das 1.100 Seiten umfassende Gutachten des Bundesamts für Verfassungsschutz
- Wieso dagegen sein?
4.1. Ein Verbot stärkt das Märtyrertum der AfD nicht!
Viele denken: Ein Verbot stärkt nur das Märtyrertum der AfD. Das Argument aber blendet
aus: Die AfD ist längst kein randständiges Phänomen mehr, das durch staatliche Sanktionen
erst zu Bedeutung gelangt. Im Gegenteil: Sie ist vielerorts bereits eine zentrale politische
Kraft – mit massiver öffentlicher Aufmerksamkeit, wachsender Wähler*innenbasis und
strukturellem Einfluss.
In mehreren ostdeutschen Landtagen verfügt sie über Sperrminoritäten, mit denen sie
zentrale parlamentarische Entscheidungen blockieren kann. Ihre Funktionärinnen besetzen Schlüsselpositionen in Ausschüssen, verwalten öffentliche Gelder und nutzen diese demokratischen Spielräume gezielt zur Verbreitung ihrer rechtsextremen Agenda. In einer solchen Lage ist ein Verbot kein symbolischer Akt – sondern ein konkreter Schritt zum institutionellen Selbstschutz der Demokratie. Es geht nicht darum, die AfD durch ein Verbot “wichtiger zu machen“, sondern darum, zu verhindern, dass sie weiter an Einfluss gewinnt, während sie zugleich daran arbeitet, die Grundlagen der Demokratie zu demontieren. Märtyrertum entsteht nicht durch Konsequenz – es entsteht durch das zögerliche Wegsehen.
4.2. „Ein Verbot ändert nichts an den Einstellungen ihrer Wählerinnen.“
Ja: Ein Parteiverbot ist kein Heilmittel für gesellschaftliche Einstellungen. Es kann
niemandem Hass oder Rassismus verbieten. Aber genau das ist auch nicht sein Ziel – und
darf es im Sinne des Grundgesetzes gar nicht sein. Ein Verbot richtet sich nicht gegen
Meinungen, sondern gegen eine Organisation, die systematisch daran arbeitet, die
freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen.
Die AfD bietet ihren Wähler*innen eine ideologisch geschlossene, organisatorisch gefestigte
Struktur mit millionenschwerer Parteienfinanzierung, Plattformen und juristischer
Infrastruktur. Ein Verbot entzieht dieser Struktur ihre staatlich abgesicherte
Handlungsfähigkeit:
– Es kappt die Finanzierung durch Steuergelder.
– Es verhindert, dass die AfD öffentliche Ämter übernimmt.
– Es schafft rechtliche Klarheit für den öffentlichen Dienst, die Justiz und die
Zivilgesellschaft im Umgang mit dieser Partei.
Zugleich öffnet ein Verbot gesellschaftliche Räume, in denen demokratische Kräfte wieder
sichtbarer werden können – ohne ständig durch rechtsextreme Provokationen und gezielte
Diskursverschiebung verdrängt zu werden.
Wer meint, ein Verbot sei wirkungslos, unterschätzt den Schutzwert der Institutionen für
unsere Gesellschaft.
4.3. Das wird ja eh nichts – so wie bei Compact!
Ein Parteiverbot darf kein Mittel politischer Opportunität sein. Deswegen sind die Hürden
dafür sehr hoch. Aber:
Diese Hürde bedeutet nicht, dass ein Verbot unmöglich ist. Sie bedeutet lediglich, dass es
einer sehr gründlichen und rechtssicheren Vorbereitung bedarf.
Und genau deshalb ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, ein solches Verfahren in die juristische
Prüfung zu bringen.
Das 1.100 Seiten umfassende Gutachten des Verfassungsschutzes bietet eine tragfähige
Grundlage für die juristische Argumentation. Es liefert dokumentierte Belege für:
– die systematische Verbreitung verfassungsfeindlicher Ideologie,
– die strategische Unterwanderung demokratischer Strukturen,
– die enge Vernetzung mit anderen rechtsextremen Akteuren,
– sowie den zunehmenden Einfluss auf Gesetzgebungs- und Verwaltungsprozesse.
Die Verantwortung liegt nun bei den Antragsteller*innen – also Bundestag, Bundesregierung
oder Bundesrat –, diese Einschätzungen rechtlich zu prüfen und eine fundierte Klage
vorzubereiten. Die Bundesregierung wird es nicht tun. Deshalb ist jetzt der Bundesrat
gefragt!
Deshalb: Los geht’s! Die AfD ist kein demokratischer Unfall, sondern das Ergebnis
systematischer Verharmlosung, strategischer Tabubrüche und bewusster Hetze.
Unsere Demokratie steht an einem Scheideweg:
Warten wir weiter ab – oder handeln wir?
Ein AfD-Verbotsverfahren ist keine Garantie für den Erhalt der Demokratie. Aber es ist ein
notwendiger Schritt, um unsere Verfassung zu verteidigen – mit den Mitteln des
Rechtsstaats.
Wir rufen dazu auf, dass Baden-Württemberg gemeinsam mit anderen Ländern den ersten
Schritt macht. Unsere Demokratie ist stark genug, um sich zu verteidigen. Aber sie muss es auch wollen.

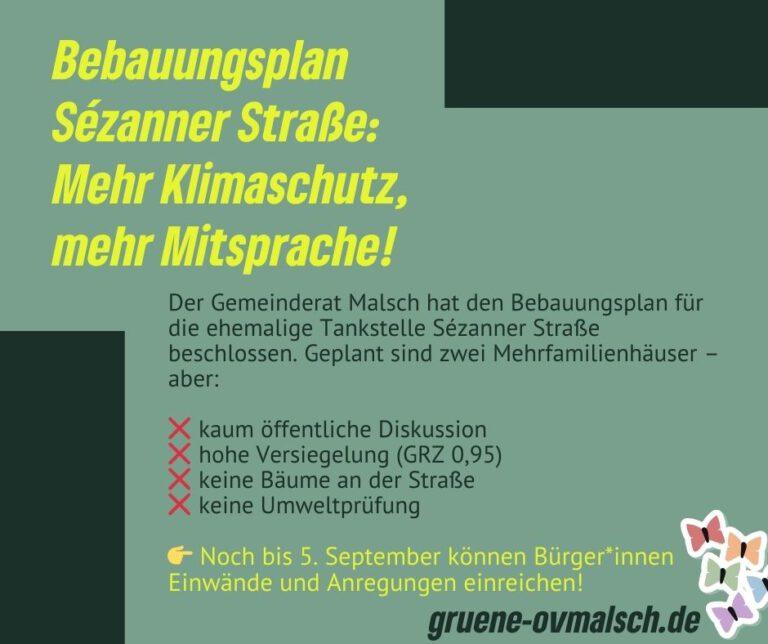
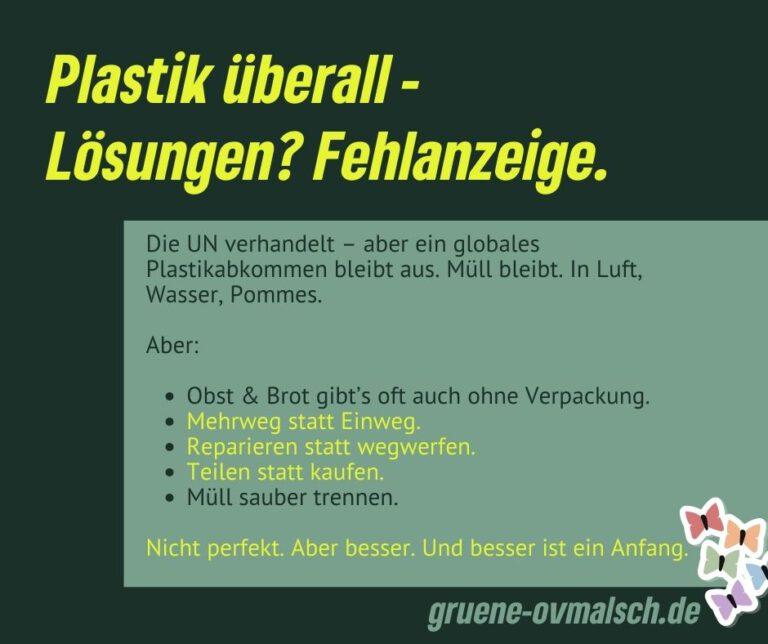
Artikel kommentieren
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.